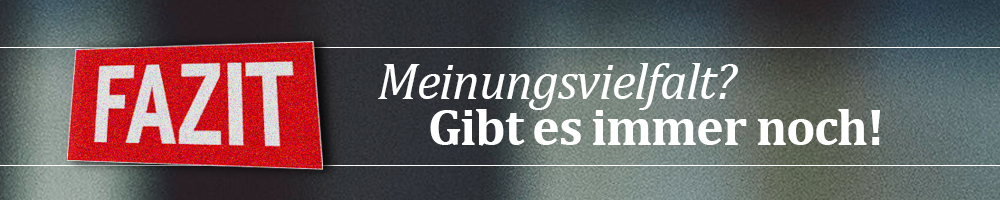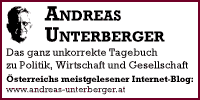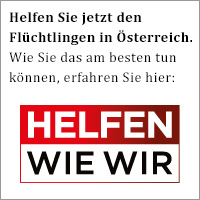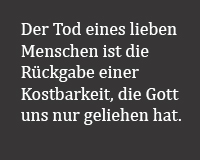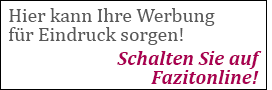Tandl macht Schluss (Fazit 209)
Johannes Tandl | 16. Januar 2025 | Keine Kommentare
Kategorie: Fazit 209, Schlusspunkt
Mehr direkte Demokratie wagen? Trotz der zuletzt gestiegenen Wahlbeteiligung erodiert das Vertrauen in die politischen Institutionen. Die gesellschaftliche Spaltung führt inzwischen sogar dazu, dass die repräsentative Demokratie in Österreich in eine veritable Legitimationskrise zu schlittern droht.
::: Hier können Sie den Text online im Printlayout lesen: LINK
Mehr direkte Demokratie wagen? Trotz der zuletzt gestiegenen Wahlbeteiligung erodiert das Vertrauen in die politischen Institutionen. Die gesellschaftliche Spaltung führt inzwischen sogar dazu, dass die repräsentative Demokratie in Österreich in eine veritable Legitimationskrise zu schlittern droht. Denn selbst wenn sich diesmal drei Parteien zusammentun, um die FPÖ nicht in die Regierung zu lassen, wird das auf Dauer einen FPÖ-Bundeskanzler nicht verhindern. Dass weite Kreise in der ÖVP, aber auch in der SPÖ schon jetzt einer Zweierkoalition, mit Herbert Kickl als Kanzler, der Ampel den Vorzug geben würden, darf als gegeben angenommen werden.
Unabhängig davon, ob die Ampel zustande kommt, setzt sich die gesellschaftliche Spaltung fort. Und vielleicht sollte man den drohenden weiteren Legitimationsverlust der repräsentativen Demokratie zum Anlass nehmen, endlich plebiszitäre Elemente in die Verfassung aufzunehmen. Denn was spricht dagegen, wenn etwa NGOs oder die Oppositionsparteien das Recht bekommen, mit einer gewissen Anzahl von Unterschriften eine verbindliche Volksabstimmung über ein Gesetzesvorhaben oder einen Änderungsvorschlag zu erzwingen?
Bisher sind Plebiszite ja nur bei der Änderung eines Baugesetzes unserer Verfassung verpflichtend. Bei der Stärkung der direkten Demokratie könnte man sich durchaus an der Schweiz orientieren. Zu den Stärken des halbdirekt-demokratischen Schweizerischen Systems gehört nämlich, dass die erzielten Ergebnisse – selbst wenn sie äußerst knapp zustande gekommen sind – von allen akzeptiert und mitgetragen werden. Bürger, die selbst mitentscheiden dürfen, wären eher dazu bereit, die Konsequenzen ihrer Entscheidung mitzutragen, als wenn alles in den Elfenbeintürmen der Macht entschieden wird. Bis zur Nationalratswahl beschrieben die Politologen den Zustand unserer Demokratie mit dem Schlagwort »Politikmüdigkeit«. Dabei wurden jene Wählerinnen und Wähler als »politikmüde« bezeichnet, die lieber auf ihre Stimmabgabe verzichteten, als für eine der traditionellen Parteien zu stimmen.
Inzwischen ist es der FPÖ trotz der geschlossenen Ablehnung ihrer Ideen und Konzepte bei den meisten Journalisten gelungen, ihre Themen unter die Menschen zu bringen. Und zwar mit eigenen Propagandakanälen wie etwa FPÖ-TV. Damit konnte sie bei den »Politikmüden« punkten. In großen Massen sind bei der Nationalratswahl ehemalige Nichtwähler an die Wahlurnen geströmt, um bei der FPÖ ihr Kreuz zu machen. Und aus demokratiepolitischer Sicht ist das gut so!
Und es ist auch gut, dass die Nazikeule gegen die FPÖ wirkungslos geworden ist. Denn am linken Bias in den meisten Redaktionen hat sich auch durch die FPÖ-Wahlerfolge nichts geändert. Mit ihren eigenen Kanälen entzieht sich die FPÖ aber auch der in jeder Demokratie gebotenen Kontrolle durch die vierte Kraft – den objektiv berichtenden Medien; oder sagen wir besser, jener medialen Kontrolle, die geboten wäre, wenn das Gros der Journalisten nicht ohnehin jeden FP-Vorschlag ziemlich unreflektiert als rechtsextrem abkanzeln würde. Die Wut der FPÖ-Wähler, die deswegen enttäuscht sind, weil ihr Herbert keine Regierung bilden darf, nimmt jedenfalls stetig zu; und mit ihr der Spalt in der Gesellschaft. Daher muss die repräsentative Demokratie in die Lage versetzt werden, ihre Legitimität zurückzugewinnen. Sie muss diese Herausforderung unbedingt bewältigen. Denn sonst würden sich in Zukunft noch mehr Menschen bei der Informationsbeschaffung ausschließlich in ihren eigenen Blasen bewegen.
In fast allen europäischen Ländern wünschen sich die Bürger inzwischen übrigens mehr direktdemokratische Instrumente. Sie wollen selbst mitentscheiden und mitgestalten. So sind etwa die Schweizer bereit, sich umfassend über die zur Abstimmung stehenden Agenden zu informieren. Plebiszite zwingen die Politik dazu, ihre Ideen und Inhalte wesentlich breiter, öffentlicher aufzubereiten und zu diskutieren. Und selbst wenn die Österreicherinnen und Österreicher erst lernen müssten, dass sie sich nur selbst ins Knie schießen, wenn sie den Abstimmungszettel bei einer Volksabstimmung als Denkzettel missbrauchen, wäre es doch die Mühe wert, endlich mehr direkte Demokratie zu wagen.
Tandl macht Schluss! Fazit 209 (Jänner 2025)
Kommentare
Antworten